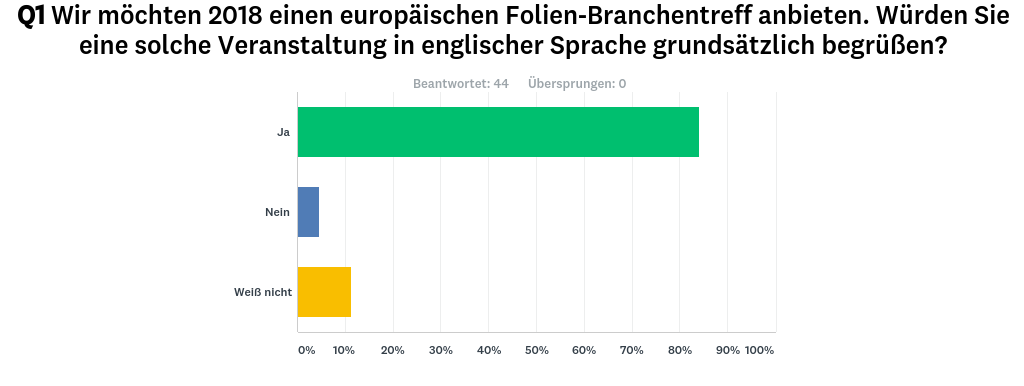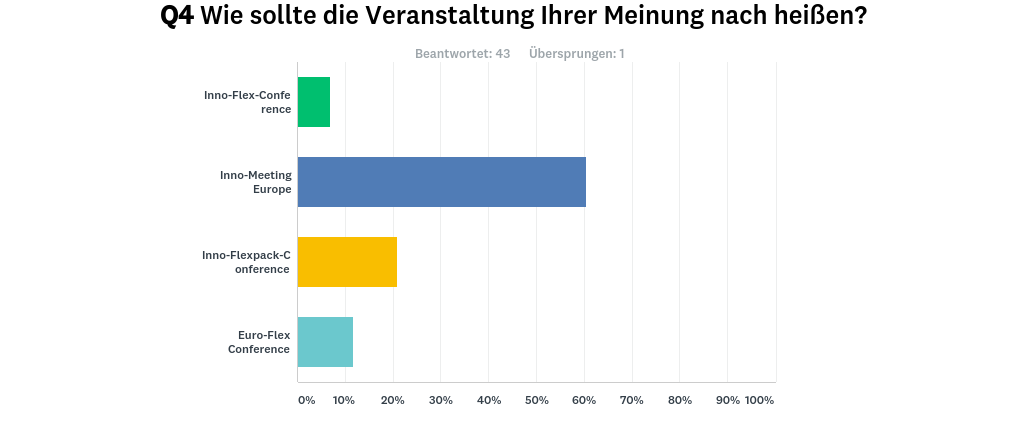Sie sind Referent in Osnabrück. Was hat Sie bewogen, der Einladung von Innoform zu folgen?
Für mich persönlich ist das eine Rückkehr zu meinen Wurzeln im Verpackungsdruck, da ich einen großen Teil meines Berufslebens mit der Formulierung lösemittelbasierender Verpackungsdruckfarben für Markenartikler verbracht habe, bevor ich mich der Strahlungshärtung zugewandt habe. Zudem ist Innoform eine renommierte Plattform für Konferenzen zum Thema Verpackungsdruck, wo sich regelmäßig Experten treffen, um über die neuesten Trends im Verpackungsdruck zu informieren und zu diskutieren.
Ihr Thema gehört zu einer Reihe von verschiedenen Blickwinkeln auf den Fokus 1st time right bzw. im ersten Anlauf klappt schon alles. Was ist Ihre Kernaussage, bezogen hierauf?
Es gibt sicher eine Vielzahl an Parametern, die darüber entscheiden, ob im Druck beim ersten Anlauf schon alles klappt; oft liegen wichtige Einflussfaktoren auch außerhalb einer Druckerei selbst. Der Digitaldruck, und hier speziell der Inkjet, geben eine neue Richtung vor, weil beim Druck mit einer festen Farbpalette und einem definierten Farbraum, wie im Inkjet üblich, bereits der erste Druck verkaufsfähig ist und so an der Druckmaschine selbst kein “Farbmanagement“ mehr über eine Änderung der Farbsysteme betrieben werden kann.
Sie referieren über Strahlungshärtung im modernen Flexo-, Offset- und Inkjetdruck. Was bewegt Sie besonders in diesem Zusammenhang?
Da ist einerseits das in einigen Märkten sich bereits vollziehende Aufeinandertreffen von traditionellen, lange etablierten Analogdrucktechnologien wie UV-Flexo oder UV-Offset auf neue, innovative Digitaldrucktechnologien wie UV-Inkjet, was uns sicher in den nächsten Jahren entlang der gesamten Wertschöpfungskette beschäftigen wird. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Lebensmittelkontaktkonformität in der Strahlenhärtung, wo bereits große Fortschritte gemacht worden sind, aber weiterhin Handlungsbedarf besteht, da gesetzliche Rahmenbedingungen kontinuierlich verschärft werden und Vorgaben global agierender Markenartikler stetigen Veränderungen unterliegen.
„Strahlenhärtung steckt in der Nische“, titelten viele noch vor wenigen Jahren. Wie schätzen Sie das insgesamt und besonders für UV-LED ein?
Wenn man sich den globalen Verpackungsmarkt in puncto Volumen oder Wert anschaut, so ist die Strahlenhärtung immer kein Big Player. Aber dort, wo die Strahlenhärtung eine dominante Marktposition erreicht hat und eine Schlüsseltechnologie ist wie im Etikettendruck, ist das Wachstum ungebrochen. Auch bisher unerschlossene Verpackungsdruckmärkte – wie der Wellpappendruck – beginnen, sich der Strahlenhärtung zuzuwenden. Mit der UV-LED-Technologie wird es in Zukunft – zumindest aus technologischer Sicht – auch erstmals möglich sein, dünne Foliensubstrate passergenau im Mehrfarbendruck zu bedrucken, was mit herkömmlichen UV-Lampensystemen bis dato aufgrund ihrer Wärmeabstrahlung und den damit verbundenen Passerproblemen beim Druck auf nicht-dimensionsstabile, dünne Foliensubstraten nicht möglich war.
Wo sehen Sie für die Verpackungsdrucker momentan besonderen Handlungsbedarf?
Unabhängig von allen technologischen Entwicklungen müssen wir uns in der Verpackungsindustrie gesellschaftspolitisch die Frage stellen, wieviel Verpackung braucht der Mensch eigentlich. Dass eine Verpackung in den meisten Fällen zwingend notwendig ist und viele Vorteile hat, ist unbestritten, aber ausgelöst durch das Thema Mikroplastik wird auch die Verpackungsindustrie ihre diesbezüglichen Zukunftsstrategien kritisch hinterfragen müssen, da diese Thematik die Verpackung dauerhaft in den Fokus der öffentlichen Diskussion rücken wird.
Was erwarten Sie persönlich von der Zuhörerschaft?
Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion zu den technischen Sachverhalten, da andere Blickwinkel die eigene Sicht der Dinge immer verbessern und kritisches Hinterfragen der eigenen Position immer notwendig ist.
Konferenzen zum Thema Drucken erfreuen sich größerer Beliebtheit als noch vor einigen Jahren. Woher kommt Ihrer Meinung nach dieses gesteigerte Interesse an Wissen und Kontakten?
Zum einen wird der zur Verfügung stehenden Pool an Drucktechnologien immer größer und komplexer, wo besonders die digitalen Druckverfahren als Newcomer zu nennen sind, so dass es schwierig ist, bei Entscheidungsfindungen den Überblick über die teilweise rasante technologische Weiterentwicklung zu behalten. Zum anderen wird es immer diffiziler, neue Projekte und Innovationen aus eigener Kraft zu realisieren, so dass der Erfolg vielfach nur noch auf Basis von Partnerschaften und Kooperationen entlang der Value Chain möglich ist.
Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach das Zusammenwachsen von verschiedenen Druckverfahren – nicht nur in einem Unternehmen oder einer Marke – sondern sogar in einer Maschine?
Hier sind die strahlenhärtenden Drucktechnologien den anderen sicher schon um einiges voraus, denn Begriffe wie Hybriddruckmaschinen gehören dort zum gängigen Vokabular. Etikettendruckmaschinen – narrow web bis mid web – sind High-Tech-Druckanlagen, die oft 2 oder 3 verschiedene UV-Druckverfahren inline miteinander kombinieren, um ein hochwertiges, anspruchsvolles Druckobjekt zu produzieren. So sind Druckmaschinenkonfigurationen aus UV-Offset, UV-Flexo und UV-Siebdruck oder aus UV-Inkjet und UV-Flexo keine Seltenheit.
Und dann noch eine private Frage: Was begeistert Sie außerhalb Ihrer beruflichen Tätigkeit?
Das Reisen in ferne Länder und das Kennenlernen fremder Kulturen ist für mich ein Unverzicht, da die eigenen Wertmaßstäbe, was im Leben wichtig und was eigentlich unwichtig ist, manchmal einer Korrektur bedürfen.
Jürgen Baro hat 1987 in Physikalischer Chemie an der Universität Göttingen promoviert.
Nach dreijähriger Tätigkeit in der Entwicklung von Druckchemikalien für den Offset- und Tiefdruck bei der Fa. E. MERCK in Darmstadt arbeitete er ab 1990 in Stuttgart bei der Fa. K+E Druckfarben – später BASF Drucksysteme und dann Flint – zunächst in der Entwicklung von Offsetdruckfarben und dann im Technischen Marketing für Flexodruckplatten und Dispersionslacke. Ab 2001 war er in Willstätt verantwortlich für die technische Marktbearbeitung lösemittelbasierender Flexo- und Tiefdruckfarben für den Verpackungsdruck.
2006 trat er als Technical Key Account Manager Europa für Rohstoffe für die Druckfarben- und Klebstoffindustrie bei der Fa. Cognis in Düsseldorf ein, um dann ab 2007 global die Abteilung Forschung und Entwicklung sowie europaweit das Ressort Anwendungstechnik für die Plattform strahlenhärtender Rohstoffe in Ponthierry in Frankreich zu leiten.
Seit 2011 ist er bei der BASF in Ludwigshafen zuständig für das Technische Marketing Europa von strahlenhärtenden Rohstoffen für Druck- und Verpackungsanwendungen.